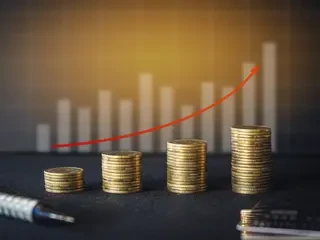Angesichts der täglichen Nachrichtenflut fällt vielen Anlegern ein nüchterner Blick auf die Börse schwer. Die anhaltenden Kursausschläge sind für Entscheidungen eine Herausforderung. Da hilft es, sich die langfristig am Kapitalmarkt möglichen Renditen zu vergegenwärtigen.
Der Kapitalmarkstrategie Tilmann Galler von der J.P. Morgan Bank hat seine Prognose im November 2025 aktualisiert.
JP Morgan ist in ihrem langfristigen Kapitalmarktausblick für folgende Anlagemöglichkeiten auf die kommenden zehn bis 15 Jahre durchaus optimistisch
Diese Renditen winken bei Aktien, Anleihen und Gold
- globales Aktienportfolio 6,4 %p.a.
- Anleihen High-Yield-Bonds Unternehmensanleihen 5,3 % p.a.
- Emerging-Markets-Anleihen 6,1 % p.a.
- Gold 5,5 % p.a.
Vieles, was Anlegerinnen und Anleger derzeit beunruhigt und die Märkte bewegt, dürfte aus unserer Sicht langfristig in den Hintergrund treten.
Im ersten Teil der Serie haben wir uns mit dem Thema Stolz bei der Geldanlage beschäftigt. Dabei wurde erläutert, dass Prognosen zu falschen Überzeugungen führen und langfristig für den Anlageerfolg eher hinderlich als hilfreich sind. Welche weiteren „Todsünden“ gibt es?
Völlerei
Wir bleiben bei provokativen und zugleich fundierten Analysen des britischen Finanzexperten James Montier. Statt übermäßigem Essen geht es bei Völlerei in der Geldanlage, um die Tendenz gierig nach Informationen zu sein und exzessiv viele Daten aufzunehmen, obwohl diese häufig keinen tatsächlichen Mehrwert für die Entscheidungen liefern. Diese Informationsvöllerei führt paradoxerweise oft zu schlechteren Investitionsentscheidungen.
In der Regel glauben Menschen, mehr Informationen würden automatisch zu besseren Entscheidungen führen. Dieser Glaube steht im Widerspruch zu zahlreichen empirischen Befunden der Verhaltensökonomik. Studien zeigen, dass ab einem bestimmten Punkt zusätzliche Informationen eher zu kognitiver Überlastung führen – eine Art mentaler "Verdauungsstörung", um im Bild der Völlerei zu bleiben.
Informationsvöllerei und die Illusion der Kontrolle
Ein zentrales psychologisches Phänomen ist die Illusion der Kontrolle. Investoren glauben, dass sie durch umfangreiches Research, detaillierte Analysen und den Zugriff auf möglichst
viele Datenpunkte bessere Entscheidungen treffen können. In Wirklichkeit überschätzen sie dadurch ihre Fähigkeit, Märkte vorherzusagen oder Risiken präzise zu kalkulieren.
Es gibt Studien, in denen Probanden trotz umfassender Information keine besseren Entscheidungen trafen als solche, die mit deutlich weniger Input auskommen mussten. Vielmehr neigen überinformierte Investoren dazu, über zu analysieren und sich in Details zu verlieren, was die Entscheidungsfindung erschwert.
Aktionismus als Folge der Völlerei
Ein weiteres typisches Verhalten ist übermäßiger Aktionismus. Anleger, die sich mit Informationen überfüttern, fühlen sich oft gezwungen, zu handeln – ganz nach dem Motto: "Ich habe so viel recherchiert, jetzt muss ich auch etwas tun." Dieser Impuls führt zu häufigem Umschichten des Portfolios, was in der Regel mit höheren Transaktionskosten und schlechteren Renditen einhergeht.
In der Behavioral Finance spricht man hier vom Overtrading, ein Phänomen, das besonders bei Privatanlegern, aber auch bei institutionellen Investoren beobachtet werden kann. Studien zeigen, dass Investoren, die besonders aktiv handeln, im Durchschnitt schlechter abschneiden als jene, die ruhig und langfristig agieren – ein klassisches Beispiel für den Schaden, den geistige Völlerei
anrichten kann.
Gegenstrategien: Fasten im Kopf
Statt sich dem ständigen Informationsstrom hinzugeben, sollten sich Anleger auf das Wesentliche konzentrieren: Fundamentaldaten, langfristige Perspektiven und ein klares, diszipliniertes Anlagekonzept. Auch das bewusste Ignorieren von kurzfristigen Marktgeräuschen – oft als "Noise" bezeichnet – gehört zu dieser Strategie.
Behavioral Finance zeigt uns, dass menschliches Verhalten in Finanzfragen oft alles andere als rational ist. Die geistige Völlerei steht exemplarisch für eine der vielen kognitiven Verzerrungen, denen Investoren unterliegen. Wer langfristig erfolgreich investieren will, sollte lernen, nicht nur auf den Informationshunger, sondern auch auf die innere Disziplin zu achten – manchmal ist weniger eben wirklich mehr.
Lust
Wie in so vielen Bereichen des Lebens spielen Emotionen auch bei der Geldanlage eine zentrale Rolle. Lust ist dabei ein Begriff, der auf den ersten Blick eher aus der Moraltheologie stammt, aber hier eine tiefsitzende menschliche Schwäche beschreiben soll: die Verliebtheit in eine Idee oder ein Investment – und die damit verbundene Unfähigkeit, rational zu bleiben.
Lust als emotionale Verzerrung
Im Kontext der Behavioral Finance steht „Lust“ nicht für sexuelles Verlangen, sondern für emotionale Verliebtheit – in eine Aktie, eine Investmentidee, ein Unternehmen oder gar in die eigene Meinung. Die emotionale Bindung bringt Investoren dazu, objektive Fakten zu ignorieren oder Risiken zu unterschätzen. Wer „verliebt“ ist, neigt dazu, die Realität zu verzerren – genau wie in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Diese Art der Lust zeigt sich häufig, wenn Anleger eine Aktie „lieben“ oder ein Unternehmen „bewundern“. Beispiele dafür gibt es viele: Technologieaktien in der Dotcom-Blase, Meme-Stocks wie GameStop oder AMC, oder auch Bitcoin in seinen euphorischen Phasen. Die emotionale Aufladung dieser Investments führt dazu, dass rationale Bewertungen kaum noch eine Rolle spielen – es zählt nur noch das „Gefühl“, Teil von etwas Besonderem zu sein.
Die Gefahr der Selbstüberschätzung
Ein typisches Begleitphänomen der Lust ist die Selbstüberschätzung. Wer sich in seine Idee verliebt hat, hält sich oft für klüger als den Markt. Man ignoriert widersprüchliche Informationen, weil sie das eigene Narrativ stören könnten. Psychologen sprechen hier von Bestätigungsfehlern (confirmation bias): Menschen neigen dazu, nur die Informationen zu suchen oder wahrzunehmen, die ihre bestehende Meinung bestätigen.
Zahlreiche Studien zeigen, dass Investoren dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen, sobald Emotionen ins Spiel kommen. Sie handeln häufiger, glauben an ihre Prognosen – und verlieren dabei oft den Bezug zur Realität. Die Lust vernebelt den klaren Blick.
Verliebtheit versus Disziplin
Entscheidend sind Disziplin, Demut und Distanz im Umgang mit Investments. Emotionale Bindungen seien gefährlich, weil sie uns davon abhalten, rechtzeitig auszusteigen oder Fehlentscheidungen zu korrigieren. Die Verliebtheit in eine Aktie oder Strategie macht uns blind für Veränderungen, selbst wenn die fundamentalen Daten längst eine andere Sprache sprechen.
Ein klassisches Beispiel ist das „Hoffen auf die Rückkehr“ eines einst beliebten Investments. Viele Anleger halten an verlustreichen Positionen fest, weil sie an das ursprüngliche Narrativ glauben wollen, nicht weil es rational sinnvoll wäre. Die Lust verhindert hier das nötige Eingeständnis von Fehlern.
Gegenstrategien: Wie man diese Lust zügelt
Es gibt verschiedene Techniken, um sich vor der Lustfalle zu schützen:
Checklisten nutzen: Objektive Kriterien helfen dabei, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Wenn ein Investment nicht mehr den eigenen Anlageprinzipien entspricht, sollte es verkauft
werden – auch wenn es „weh tut“.
- Pre-Mortem-Analysen durchführen: Vor einer Investition stellt man sich vor, dass diese scheitert – und analysiert dann, was die Gründe dafür gewesen sein könnten. Diese Denkweise hilft, blinde Flecken aufzudecken.
- Peer-Review-Systeme etablieren: Wenn mehrere Personen Entscheidungen gemeinsam hinterfragen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in eine Idee „verliebt“, ohne auf kritische Stimmen zu hören.
- Emotionale Distanz wahren: Aktien sind keine Menschen. Man kann (und sollte) sich von ihnen trennen, wenn sie nicht mehr zum eigenen Anlageziel passen. Persönliche Zuneigung hat in der Geldanlage keinen Platz.
Wer langfristig erfolgreich investieren will, muss lernen, Emotionen wie Lust zu erkennen, zu kontrollieren und manchmal auch bewusst zu ignorieren. Denn wie Herr Montier treffend sagt:
„Die größte Herausforderung für Investoren ist nicht der Markt, sondern sie selbst.“
Drei von sieben Todsünden haben wir nun abgehandelt. In den nächsten Ausgaben werden wir die weiteren Todsünden (Neid, Habgier, Faulheit und Zorn) genauer unter die Lupe nehmen.
Gerne begleiten wir Sie bei der Auswahl künftiger Anlagemöglichkeiten.
Wichtig: Immer noch fehlende Zustimmung zur Aktualisierung Vertragsunterlagen bei unseren FFB-Kunden!
Bitte stimmen Sie den aktualisierten AGBs der FFB online über ihren Depotzugang zu. Falls Sie Fragen dazu haben oder Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.
Gerne begleiten wir Sie bei der Auswahl künftiger Anlagemöglichkeiten.
Es grüßt Sie

 Alexander Tutmann
Alexander Tutmann